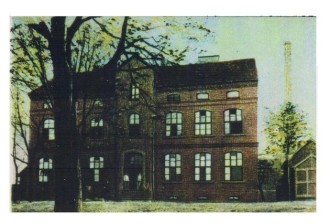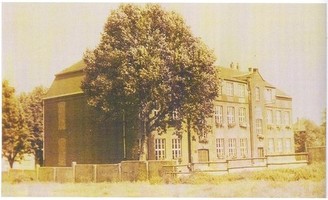Kontakt
Hellweg Grundschule
Am Petersheck 9
44319 Dortmund
Telefon: 0231 - 28673660
Telefax: 0231 - 28673668
hellweg-grundschule@stadtdo.de
Unsere Öffnungszeiten
Mo., Do. :
07:30 - 13:30
Di., Mi. :
07:00 - 13:30
Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören!
Die Homepage der Hellweg Grundschule wird vom Förderverein finanziert!
Schulchronik
So fing alles an:
1742 - 1789
Gottfried Reinhardt Lehnemann (Küster und Lehrer) leitet
eine evangelisch lutherische Schule in Asseln mit 83 Schülern
1859
Nach der Pensionierung seines Nachfolgers Thomas Bülle wurden
zwei neue Lehrer eingestellt: Lehrer M. Luther und Lehrer Gördel
1860
Eine neue Schule „Am Hagedorn“ wird errichtet. Sie trägt den
Namen "Friedrichschule"
1863
Asseln hat 102 Schülerinnen und 115 Schüler
1875
Zu Ostern steigt die Schulkinderzahl auf 400. In der 3. Klasse sind 153 Schüler. Ein vierter Lehrer wird notwendig.
18.10.1875
Eine neue Schule wird "Am Petersheck" eingeweiht. Das Gebäude (heutiger Altbau- linker Seiteneingang) hat 4 Klassenzimmer, vier Lehrer und zwei Wohnungen für Lehrer
13. 11.1900
Das Schulgebäude „Am
Petersheck 9“ wird wegen der wachsenden Schülerzahl (452) vergrößert und fertiggestellt. Es hat nun 8 Klassenraume und 3 Lehrerwohnungen.
1909
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt auf 635. Ein neuer Lehrer wird eingestellt.
Der Zeitraum von 1910 bis 1972 wird momentan noch bearbeitet.
1972 - 73
Auflösung der kath. Schule an
der Asselburg. Übernahme der Lehrerinnen
der kath. Schule. Frau S. Joneit beginnt die Arbeit als Leiterin des Schulkindergartens der Hellweg – Grundschule
1974 - 75
Frau A. Westhausen wird neue Konrektorin
Teilnahme am Schulversuch "Englisch in Grundschulen"
1976 - 77
Neue Zeugnisregelung: Die Kinder der ersten beiden
Jahrgänge erhalten in den Zeugnissen anstelle von Zensuren Hinweise zum Arbeits - und Sozialverhalten, Einführung des neuen Schulmitwirkungsgesetzes
1980/81
Am 01.09.80 übernahm Herr D. Hugo die Stelle des
Konrektors
29.05.1982
Teilnahme am großen Bürgerfest :"1100 Jahre
Asseln"
Schülerzahl: 271 in 12 Klassen und im Schulkindergarten
1984/85
Frau Ch. Wrede und Herr F. Kallenbach werden neu
eingestellt.
Schülerzahl: 262. Bildung von Schülearbeitsgemeinschaften
ab 01.08.1985
sind für die ersten beiden Schuljahre die neuen
Richtlinien in Kraft getreten
1988/89
Einrichtung einer Integrationsklasse
Schülerzahl : 289 in 12 Klassen
1989/90
Am 11.09.89 kommt Frau I. Seiler als Konrektorin an
die Hellweg - Grundschule, wird am 31.07.91 zur Rektorin ernannt.
1991
Zum 01.August 91 kommt Herr U. Sommer als Konrektor und
wird mit Wirkung vom 22 November 2001 zum Rektor ernannt. Neue Konrektorin an der Hellweg - Grundschule: Frau A. Borrusch
01.09.2000
Schülerzahl : 320 in 15 Klassen mit 13
Lehrer
10.2000
Großes Kulturprogramm am Festtag: "125 Jahre
Hellwegschule" mit Unterricht wie zu Kaisers Zeiten
2002
14.September:Schließung des maroden Pavillons an der
Hellweg - Grundschule nachdem ein Fenster nach innen auf einen Schülertisch gestürzt war. Feuchtigkeit und Schimmel in den Räumen durch defekte Fensterrahmen und undichte Dachisolierung. Zwei
Schulklassen müssen bis zur Fertigstellung eines Ersatzgebäudes in der Europaschule (Gesamtschule in Wambel) untergebracht werden. Die Kinder werden von der Bezirksvertretung mit Pausenspielgeräten
versorgt.
2004
Am 07. Juni wird endlich der neue Pavillon, ein Modulbau mit Klinkerfassade eingeweiht. So stehen drei weitere Klassenräume mit Lehrerzimmer und für die Ganztagbetreuung zwei Gruppenräume und ein Speiseraum zur Verfügung. Die geplanten Räumlichkeiten für Kinder - und Jugendarbeit wurden nicht bewilligt.